Der große Schlesier – Józef Kożdoń (1)
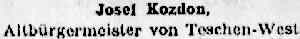

Ehrenbürger von Teschen
Teil I
J. Kożdoń bleibt auf Anordnung der Behörden unbekannt. Sein Leben und seine politischen und öffentlichen Aktivitäten waren ganz auf Österreichisch-Schlesien ausgerichtet, und nach dem tragischen Tag des 28. Juli 1920, als diese Gemeinschaft von Menschen und Kultur – dieses Teschener Heiligtum – auf tragische Weise auseinandergerissen wurde, stand er bereits auf der Seite der Tschechoslowakischen Ersten Republik. 1923 wurde er zum Bürgermeister von Český Těšín gewählt und blieb bis zur polnischen Annexion von Zaolzie im Jahr 1938 im Amt.
Koźdoń hat hier mehr aufgebaut als Grażynski, der Gouverneur von Schlesien, in ganz Oberschlesien. Er hatte ein arbeitsreiches und politisch aktives Leben. Er war jedoch kein revolutionärer Politiker, Aufständischer oder jemand, der Gewalt anwendete. Er war bereit, die Politik aufzugeben, wenn die äußeren Bedingungen keinen Erfolg versprachen. Dann widmete er sich der öffentlichen und wirtschaftlichen Arbeit – für die Menschen. Er war ein Sohn dieser Region – der Region Teschen-Schlesien, er hatte viele Freunde, aber auch eine Menge Feinde, die in Wellen aus Galizien kamen, oft über Wien. Heute ist er selbst in Teschen unbekannt, und die sogenannten polnischen Patrioten haben sich in Schlesien niedergelassen. Diese Handvoll Patrioten in Zaolzie ist der Meinung, dass er (am besten zusammen mit seiner Frau) hätte neutralisiert werden sollen. Diese Meinung wird auch heute noch von der polnischen „Staatsräson“ unterstützt – darunter beispielsweise K. Nowak – Praca Naukowa Uniwersytetu Śląskiego nr 1492 – Katowice 1995 – Titel: Ruch kożdoniowski na Teschener Schlesien. Ich zitiere aus diesem „Werk“: „Es scheint, dass der Fehler polnischer nationaler Aktivisten (Jan Michejda, Pater Londzin, K. Matusiak, …) in ihrer Unentschlossenheit gegenüber dem Vorsitzenden der Schlesischen Volkspartei (Śląska Partia Ludowa) lag. Z. Kirkor-Kiedroniowa hatte Recht, dass Kożdonia in den Jahren 1918–1920 unter Berücksichtigung der polnischen Interessen in Teschen-Schlesien lieber dauerhaft hätte eliminiert werden sollen, als passiv seinen Übergang ins tschechische Lager zu beobachten. – Z. Kirkor-Kiedroniowa. Erinnerungen Teil 2. Das Land meines Mannes. Krakau 1988. Ähnlich hatte Henryk Jasiczek bereits angenommen, dass Kożdoni 1951 in der Zaolzie-Zwrot hängen würde, und befürchtete, dass nach 1945 nur – „Einer der kleineren ‚Abtrünnigen‘ J. Golec (nach Z. Jasiński) gibt im Biografischen Wörterbuch der Region Teschen ebenfalls eine negative Einschätzung von ihm ab.
Józef Koźdoń wurde am 8. September 1873 in Leszn a Górna in eine Bauernfamilie geboren. Er besuchte die örtliche Grundschule und schloss 1892 die deutsche Lehrerbildungsanstalt in Teschen ab. Es sollte daran erinnert werden, dass Schlesien zunächst formell zu Böhmen gehörte (ab 1335 zu Trenčín und Vyšehrad) und dann (ab 1526) zu den Habsburgern. Während dieser Jahrhunderte verfügte Schlesien über Freiheiten und Entscheidungsbefugnisse, die von keiner der sogenannten Autonomien, die wir kennen, erreicht wurden. Im Jahr 1337 erließ Johann von Böhmen, König von Böhmen, in Breslau eine organisatorische und wirtschaftliche Verfassung, d. h. eine Verordnung – eine allgemeine Anordnung für Schlesien –, die unter anderem unter anderem weitreichende Befugnisse für den Starosten von Breslau, die Unterordnung der Ritter des Herzogtums Breslau auf dem Gebiet von Breslau unter das städtische Gericht, die Einschränkung der Befugnisse der Kirchengerichte gegenüber Laien, er richtete auch einen zweiten Jahrmarkt ein, legte die Regeln für die Schifffahrt auf der Oder fest, führte bestimmte Zollfreiheiten ein und vieles mehr. Im Vergleich dazu kann man davon ausgehen, dass diese Verordnung weiter ging als die sogenannte Polnische Verfassung vom 3. Mai, die etwa fünf Jahrhunderte jünger ist und zudem nicht in die Praxis umgesetzt wurde.
Koźdoń „behauptet“, sein Haymmat sei das österreichische Schlesien – von Opava, Teschen, Frydek, Jablunkov bis Strumien, Skoczow und Bielsko, und das Vaterland sei das C.K. Österreich mit seiner Hauptstadt Wien an der schönen blauen Donau. Seine Aussage über die Besonderheit Schlesiens im Verhältnis zu Polen ist daher offensichtlich und verständlich. „Ślązak“ 18.12.1909 – Zitat „Die Sprachgemeinschaft allein reicht nicht aus, um eine soziale, kulturelle und politische Gemeinschaft zu schaffen, was offensichtlich das oberste Ziel aller Polen ist. Der beste Beweis dafür ist, dass beispielsweise ein Tiroler oder Schweizer, der Deutsch spricht, mit einem Preußen nichts gemeinsam hat, außer der Sprache“ – und weiter – ‚Er kannte Schlesien oder die Jagiellonen nicht, er kannte die verschiedenen gewählten Könige nicht, er hatte keinen Anteil am Untergang des polnischen Staates, an den folgenden Aufständen usw.‘. Ich möchte hinzufügen, dass es sich um ein zweisprachiges Land handelt und sich die polnische Sprache erheblich von den lokalen Dialekten unterscheidet.
Kożdon ist ein Evangelist wie viele andere auf dieser Erde. Von 1893 bis 1898 arbeitet er an einer Schule in Strumień und später in Skoczów, wo er 1902 Schulleiter wird. Er heiratet und lernt Leute kennen. Die Menschen behandeln ihn wie einen der ihren, weil er hier zwischen Weichsel und Olsa lebt. 1908 beginnt seine politische Karriere. Er wird in die Schlesische Nationalversammlung in Opava gewählt – „hier“ hat Schlesien seit 1850 ein eigenes Parlament! Auf der ersten Sitzung am 28.12.1909 wird Kożdoń in den Ausschuss für Wirtschaft, Militär und öffentliche Sicherheit gewählt. Dr. Jan Michejda wird zusammen mit Pater Londzin, Pater Świeży und einer ganzen Reihe anderer Michejdas – ebenfalls Evangelikale, einige von ihnen Pastoren – in das Nationalparlament gewählt. Sie werden kollektiv als Aktivisten von „Michejdaland“ bezeichnet. – Franciszek, Jan, Karol, Oskar, Paweł, Tadeusz, Władysław und sie sind in „Sokół“, „Macierz“ und einer Reihe anderer Organisationen aktiv. Sie bringen die fremde Kultur der Jagiellonen und des Deutschen Ordens in dieses Land. Die hier operierenden Militärkommandeure – Matusiak, Latinik – stammen aus Galizien – Oświęcim, Tarnów. Es gibt auch andere sogenannte „Erwecker“ – Pater Stojalowski, Dobija. Alle oben genannten hatten zuvor die österreichische Staatsbürgerschaft erklärt und trugen österreichische Armeeuniformen. Diese Gruppe spielt hier die gleiche Rolle wie Korfanty, Zgrzebniok, Brandyso-wie (Pater Wolny, die Witczakowie, Mielżyński und vor allem der Diktator Grażyński in Oberschlesien).
Kożdoń sah sich daher einem soliden „Michejdeland“ von Gegnern gegenüber, die vorerst wirtschaftlich und später auch militärisch von Krakau und Warschau unterstützt wurden. Mitte Februar 1909 erschien die erste Ausgabe der Wochenzeitung der Kożdonia-Bewegung, „Ślązak“ – Gazeta Ludowa Organ Śląskiej Partyi Ludowej (Schlesische Volkszeitung der Schlesischen Volkspartei). Die unpolitische Schlesische Volksunion, die 1910 mit J. Kożdonia als Präsident und Sitz in Teschen gegründet wurde, war die Massenbasis der Anhänger der Schlesischen Volkspartei. Gründungsversammlung am 2. Juli 1910 – 100 Personen anwesend gemäß dem Gesetz des C.K. Austri – Ślązak 9. Juli 1910. Der Verein hat außerdem 30 Zweigstellen und über 2.000 Mitglieder. (Nach dem Austritt des östlichen Teils von Teschen auf tschechoslowakischer Seite im Jahr 1934 hat der Verein 3.552 Mitglieder in der polnischen und deutschen Sektion. Im polnischen Teil von Teschen-Schlesien ist sie verboten, und ab 1923 wird aus „Ślązak“ „Nasz Lud“ mit wenig politischem Engagement.
Die Veröffentlichung von „Ślązak“ brachte die Anhänger von Michejda, die für ganz Polen eintraten, völlig aus der Fassung. Michejda kündigte einen „ideologischen Kampf“ an. Er zögerte nicht und eine veröffentlichte „Fotokopie“ von „Ślązak“ Nr. 9 vom 10. April 1909 zeigt, wie dies in der Praxis aussah.
Die Atmosphäre jener Jahre: Um die Jahrhundertwende und bis zum Ersten Weltkrieg war Teschen eine weltoffene Stadt mit Straßen, die von Gaslaternen und ab 1910 von elektrischem Licht beleuchtet wurden. 1911 wurde eine Straßenbahnverbindung vom Hauptbahnhof (Tschechischer Teschen) nach Długi Most (Przyjaźni), Głęboka, Rynek und Wyższa Brama eingerichtet.Teschen ist eine weltoffene Stadt, in der bei einer Einwohnerzahl von 20.000 fast 200 Vereine aktiv sind. Es gibt katholische und protestantische Kirchen, es gibt das „Schlesische Haus“ im ehemaligen Hotel „Pod Złotym Wołem“, es gibt das Hotel „Pod Brunatnym Jeleniem“, es gibt das „Cafe Zentral“, es gibt die Eisenwarenhandlung von Józef Konczakowski in Teschen – k. u. k. Hoflieferant, es gibt den Hoffotografen H. C. i K. Jandaurek, ist, ist … Es gibt – gab, Historiker Gottlieb Biermann-Geschichte des Herzogthums Teschen (1863 und 1894)-(Gothic) und Authon Peter. Die Stadt lebt vom Handel und ihrer günstigen Lage. Der Burgberg ist lebendig. Es gibt Bäcker, Metzger, Dutzende von Schuhmachern, Friseure, Apotheken, Dutzende von Restaurants und Kneipen, aber der Alkohol wird in Putykas am Stadtrand verkauft. Die Stadt wird von einem Stadtrat regiert, der für einen Zeitraum von 3 Jahren gewählt wird und aus seiner Mitte einen Vorstand aus mehreren Personen wählt, an dessen Spitze der Bürgermeister steht. Seit 1861 ist dies Dr. Jan Demei, dann sein Sohn Dr. Leonhard Demei (ab 1892) und Dr. Rudolf Bukowski von 1908 bis 1913. In dieser Zeit nahm die Stadt ihre heutige Form an (und leider hat sich seitdem nicht viel geändert). Die Wasserversorgung und das Abwassersystem sind seit Jahrhunderten in Betrieb. Es gibt 8 Druckereien und ebenso viele Verlage. Seit 1860 wird auch die deutschsprachige „Silesia“ (Tageblatt) herausgegeben – in gotischer Schrift. Auf dem Oberen Marktplatz befinden sich auch die Streichinstrumentenfabrik Krywalski und die Wiener Uhrenfabrik von Jan Franka. Teschen wird auch „Klein-Wien“ genannt. Das örtliche Territorialverteidigungsregiment Nr. 100 und die Infanterieregimenter, die in den neuen Kasernen am Hang des Mały Jaworowy stationiert sind, verleihen der Stadt mit insgesamt fast 2.000 Militärangehörigen eine lebendige Atmosphäre. Teschen wurde auch regelmäßig von Kaiser Franz Joseph I. persönlich besucht, und Erzherzog Eugenius diente ab 1890 in der Garnison von Teschen. Die Militärkapelle gibt regelmäßig Konzerte. Man könnte die Aufzählung von Fabriken, kulturellen Einrichtungen usw. fortsetzen. Ein kleines Beispiel könnte ein Auszug aus den Anzeigen sein, die in der vorliegenden „Ślązak“ vom 10. April 1909 veröffentlicht wurden, sowie ein Foto des Marktplatzes von Teschen nach 1911.
Inzwischen sind wir Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. Wir schreiben das Jahr 1912. Kożdoń ist kein gewöhnlicher Mensch – er spürt die Gefahren der Zukunft – ein Beispiel dafür ist „Rede von Józef Kożdoń, Abgeordneter, gehalten auf der 20. Sitzung der 44. Sitzung des Sejm über die Schule von Sibiu“ – wie er es selbst beschreibt – eine Antwort auf… „die Eskapaden von Dr. Michejda“ vom Vortag im Sejm.
Es geht um Bildung – hauptsächlich um den Deutschunterricht. Die Nationalisten (Anhänger von Michejda) werfen Kożdoni vor, den Unterricht dieser Sprache zu unterstützen, obwohl sie selbst diese beherrschten und dadurch lukrative Positionen innehätten und sowohl in Krakau und Lemberg als auch in Wien selbst Einfluss ausübten! („Ślązak“ vom 6. April 1912) – dies ist auch eine Art Verweis auf „Ein paar Worte des Programms der Redaktion“ – „… Dies sind Einflüsse in Wien“ – Ślązak Nr. 1 1909.
Die folgenden Jahre waren Jahre der Arbeit und der Abwehr der plumpen Anschuldigungen von „Gwiazdka“ Miechejdowska auf den Seiten von „Ślązak“ sowie der Berichterstattung über die Aktivitäten des Nationalparlaments – zum Beispiel in „Ślązak“ vom 14. Februar 1914. Die Auflage von „Ślązak“, die konstant bei 4.000 Exemplaren lag, zeugt von der bedeutenden Rolle der Wochenzeitschrift.
Wir kommen zu den Ereignissen in Sarajevo, der Kriegskrise und dem Zusammenbruch des österreichischen Kaiserreichs. Dies ist eine sehr schmerzhafte Zeit für Kożdonia und die Schlesier. Die Details würden eine separate Studie erfordern. Österreichisch-Schlesien wird zwischen Polen und Tschechen aufgeteilt. Die Franzosen sind die Hauptregulatoren. Kożdonia möchte Schlesien neutralisieren. Die Franzosen wollen davon nichts hören, ebenso wenig wie die Polen und Tschechen. Die Franzosen in Versailles werden die endgültigen Entscheidungen treffen.
In der Zwischenzeit tobt vor Ort ein erbitterter Kampf. Den Schlesiern bleibt nur „Ślązak“, die Polen sind bereits militärisch organisiert, ebenso wie die Tschechen. Ślązak wird zensiert und manchmal als „staatsfeindliches“ Magazin beschlagnahmt – der Zensor ist K. Matusiak aus Galizien, der später am Militärputsch in der Garnison Teschen beteiligt ist und Ślązak unerbittlich bekämpft – unter anderem hängt er vier Ślązak in Pierściec – Ślązak 15.5.1919. Zuvor, am 30. November 1918, wurde Kożdoń unter der falschen Anschuldigung der „Aufwiegelung der Bevölkerung gegen die Autorität des Nationalrats“ in Teschen (Jan Michejda, Fr. Londzin, T. Reger, P. Bobek, K. Matusiak, Latinik) verhaftet. Nach seiner vorübergehenden Freilassung und tatsächlichen Flucht in die Tschechische Republik schrieb er selbst: „Der Nationalrat beschloss, mich wie einen gewöhnlichen Kriminellen zu behandeln, und in Richter Lukas fanden sie ein Werkzeug, um ihre Absichten zu verwirklichen. Ich wurde in eine kalte, ungeheizte Zelle geworfen. Trotz wiederholter und eindringlicher Bitten wurde erst am zehnten Tag ein Arzt geschickt. Ich durfte mein eigenes Essen mitbringen und keine Zeitungen lesen. Auch das Recht, mit meinem Rechtsbeistand zu kommunizieren, wurde mir verweigert.“ Später wurde er nach Krakau transportiert. Seine Frau wurde ebenfalls verhaftet und im Lager in Dąbie bei Krakau inhaftiert, obwohl sie sich nie politisch engagiert hatte, was Kożdoni besonders verübelte. Schlesien, 22. Februar 1919. Die deutschen Abgeordneten Dr. Bukowski, Dr. Ott und Zwilling sowie Vertreter des tschechischen Narodni Vybor intervenierten bei den polnischen Behörden zu Kożdoniens Verteidigung.
Schließlich beschlossen J. Michejda und Latinik am 28. Dezember 1918, ihn vorübergehend aus dem Gefangenenlager zu entlassen. Aus Angst um sein Leben in Teschen zieht Koźdoń sofort nach Mährisch Ostrau. Von dort aus versucht er mit Hilfe der lokalen Zeitung „Ślązak“, die Entscheidungen in Bezug auf Schlesien zu beeinflussen.
Koźdońs aufrichtige Sorge um sein Schlesien und seine Menschen lässt sich am besten anhand der Position der Schlesischen Volkspartei zur Frage der Zugehörigkeit unseres Landes veranschaulichen, wie sie auf der Delegiertenkonferenz am 8. Februar 1919 dargelegt und am 22. Februar 1919 in „Ślązak“ veröffentlicht wurde und die ich hier vollständig zitieren möchte. Koźdoń wollte zur westlichen Kulturwelt gehören! Zusammen mit Teschener Schlesien!
– Schlesische Volkspartei zum Thema der Zugehörigkeit unseres Landes –
Die Delegiertenkonferenz unserer Partei hat auf der Sitzung am 8. dieses Monats das Memorandum gebilligt, das unsere Delegation am 15. Februar bei der Anhörung der Entente-Kommission in Teschen vorgelegt hat. Dieses Memorandum endet mit dem folgenden Absatz:
„Die Natur hat uns seit Anbeginn der Zeit zusammengebunden und ein geografisches und wirtschaftliches Ganzes und eine untrennbare Einheit geschaffen, und die historische Entwicklung mehrerer Jahrhunderte hat dieses organische Ganze zu einem Ganzen zusammengefügt, das menschliche Hände nicht um vorübergehender politischer Ambitionen willen teilen oder auseinanderreißen sollten. Wir haben trotz sprachlicher Unterschiede eine kulturelle und wirtschaftliche Gemeinschaft geschaffen und wollen in dieser weiter bestehen. Wir haben unsere Heimat Österreich verloren und wollen unsere umstrittene und liebe Heimat nicht verlieren. Unsere Liebe und Verbundenheit zu dieser gemeinsamen Heimat, unsere Liebe zu den Menschen, die in diesem Land leben, ist unser wichtigstes Gut. Wir fühlen uns als sein Fleisch und Blut und wollen unsere Stammesidentität so lange wie möglich bewahren. Wenn wir in zwei Länder aufgeteilt werden, riskieren wir, auseinanderzufallen und zu verschwinden. Wenn wir eine Einheit und ein Ganzes schaffen, können wir ausländischen Einflüssen wirksamer widerstehen und das, was uns gehört, wirksamer verteidigen und bewahren. Deshalb fordern wir:
- Teschner Schlesien ungeteilt bleiben
Wir würden wahrscheinlich lieber unser Motto sehen: „Schlesien für die Schlesier“!Unser Land soll eine unabhängige Republik unter dem Schutz der Völkergemeinschaft bilden. Dies ist auch unsere Hauptforderung.
- Wenn die Weltfriedenskonferenz anerkennen sollte, dass ein solcher Plan nicht realisierbar ist, dann bitten wir aus den genannten Gründen:
- Möge unser Land, möge Teschener Schlesien in die Tschechoslowakei, in die westliche Welt und in die westliche Kultur eingegliedert werden
Westliche Zivilisation, mit folgenden Vorbehalten
a) Möge der Schlesier bleiben, was er ist, was er seit Jahrhunderten ist, möge er auch in Zukunft frei sein, sich zu seinem Glauben zu bekennen, ohne Unterdrückung oder Zwang. Möge der freie Sohn dieses Landes Herr des freien Bodens Schlesiens sein: der freie Schlesier!
b) Die nationalen Beziehungen sollten auf der Grundlage einer vollständigen nationalen Autonomie geregelt werden, die sich auch auf die Achtung des Willens des Einzelnen erstreckt. Außerdem sollten die besonderen und unterschiedlichen Beziehungen dieses Landes, seine politische und kulturelle Besonderheit, berücksichtigt und so bewahrt werden, dass unser Land eine separate Provinz mit weitreichender Selbstverwaltung bilden würde.
c) Bei der Besetzung von Ämtern und Schulen ist der einheimischen Bevölkerung der Vorrang zu geben. Die künftigen Behörden haben sich besonders zu kümmern: um die Pflege und Erhaltung aller Zeichen der eigenartigen Kultur des Landes und des Volkes. So soll der Dialekt der Bevölkerung respektiert bleiben, die Bräuche und Traditionen unseres Volkes sollen nicht verletzt werden, die Behörden sollen sich sorgfältig um die Erhaltung der charakteristischen Tracht der Landbevölkerung sowie anderer Denkmäler und Zeugnisse der historischen Entwicklung der Schlesier kümmern.
Wir würden das Denkmal als erhaben einstufen, aber Koźdoń war sich bewusst, dass die internationale Kommission, die am 12. Juli 1919 in Teschen eintraf, auf praktische Lösungen und den politischen Druck der interessierten Parteien achten würde. Einzelne Projekte mussten nicht von allen Mitgliedern der Kommission genehmigt werden.
Die Mitglieder der Kommission waren: Grenard aus Frankreich, Coulson aus England, Tissi aus Italien und Dubois aus den Vereinigten Staaten.
Im April 1919 schlug Grenard eine Grenze vor, die entlang der Wasserscheide zwischen Weichsel und Olsa verlaufen sollte. Die anderen Mitglieder der Kommission schlugen die Schaffung eines unabhängigen Staates aus Schlesien unter dem Schutz der Entente vor. E. Beneš schlug Anfang des Frühjahrs 1919 bei Gesprächen mit polnischen Diplomaten in Paris eine Grenze entlang der oberen Weichsel vor. Die Polen hingegen forderten ganz Schlesien ohne den Bezirk Frýdek. Beneš‘ Kompromissvorschlag kam dem heutigen Grenzverlauf nahe und wurde von Masaryk unterstützt. Die Deutschen in Ostrava und im Teschener Schlesien forderten in Absprache mit der Schlesischen Volkspartei unter der Führung von J. Koźdoń, dass aus dem Industriegebiet ein neutraler Staat geschaffen werden sollte, aber Koźdoń wollte nicht, dass Schlesien geteilt und auf ein Industriezentrum beschränkt wird. Es gab Pläne, sich mit Oberschlesien zusammenzuschließen. Der Franzose war ein entschiedener Gegner dieser Pläne der Kommission und auch des Obersten Rates in Versailles. Es gab auch andere Vorschläge. Da keine Einigung über die Grenze erzielt werden konnte, beschloss der Oberste Rat in Versailles am 11. September 1919, bestätigt am 27. September, eine Volksabstimmung in Teschener Schlesien abzuhalten. Diese Entscheidung war eigentlich günstig für Kożdion – er konnte mit einem Erfolg rechnen. Aber bis zur Volksabstimmung war es noch ein weiter Weg.
Ewald Bienia
Der Text wurde in der Schlesischen Schwalbe (Jaskółka Śląska), Teil I, im Oktober/November 1996 veröffentlicht.
Quelltext aus: silesiainfo.net/SilesiaArchiv/SlonskDe/Slonsk/Aebi/JK/JKozdon1.htm
. . .


Weitere Informationen zu Aktivitäten von Józef Kożdoń unter: deutsch.wikibrief.org/wiki/Silesian_People%27s_Party
„Die Schlesische Volkspartei war eine politische Organisation in Cieszyn Schlesien, die von 1909 bis 1938 in Österreichisch-Schlesien existierte Territorium und schließlich Teil der Tschechoslowakei. Der Partei gehörten vor allem Slawen an, die sich als Angehörige einer schlesischen Nation sahen. Die Partei wird als Teil der Szlonzakischen Bewegung ( polnisch : ruch ślązakowski, tschechisch : Šlonzácké hnutí, deutsch : Schlonsakenbewegung) oder der schlesischen Separatistenbewegung angesehen. …“